Abschied vom Publikum
Warum es Sinn macht sich unter den gegebenen Diskursen des Kreativen von der Idee des Publikums zu lösen und Alternativen zu suchen.
Der Kultursoziologe Andreas Reckwitz hat mit seinem Buch "Die Erfindung der Kreativität" [1] eine ebenso scharfsinnige wie erhellende Studie vorgelegt, die es uns ermöglicht zu verstehen, wie es zu einem Kreativitätsdispositiv als bestimmendes Merkmal unserer Zeit gekommen ist. Kreativitätsdispositiv verstanden als die Gesamtheit aller Praktiken, Techniken und Einstellungen, die nahelegen Kreativität nicht bloß als abfragbare Fähigkeit, sondern als Wunsch, und mehr noch als Befehl zu verstehen. Man muß letztlich Kreativ sein wollen.
Daß es innerhalb dieses Kreativitätsdispositivs und der aus ihm resultierenden Kreativökonomie, - prägnant auch als "ästhetischer Kapitalismus" beschrieben -, nicht nur Gewinner gibt, ist auch Reckwitz nicht entgangen. Stichwort (Selbst)Prekarisierung. Der Kehrseite des Kreativitätsdogmas widmet der Autor unter dem Kapitel "Dissonanzen kreativer Lebensführung" allerdings nur vergleichsweise wenige Seiten.
Dennoch versucht Reckwitz zum Ende seines Buches einige Überlegungen, wie die Allmacht des Kreativitätsdispositivs in Frage gestellt werden könnte. Eine davon gilt der Rolle des Publikums.
Das Publikum ist eine der vier tragenden Säulen des Kreativitätsdispositivs. Neben ihm stehen die Produzenten (Künstler) ästhetischer Objekte, die ästhetischen Objekte (Kunstwerke) selbst, sowie Institutionen der Aufmerksamkeitsregulierung (Museen, Theater, Kuratoren, Medien). Ihnen alle ist gemeinsam, daß nur ästhetisch Neues und gegenüber einem Kanon differentes positiv geschätzt werden kann.
Erfolg bedeutet in diesem Modell vor allem Erfolg beim Publikum, verstanden als eine tendenziell ästhetisch geschulte, teils komplizenhafte, letztlich aber namenlose und unverbindliche Zahl.
Problematisierung des Publikums
Zusätzlich zu den Ausführungen von Reckwitz, der die Beziehung zwischen Produzenten und Rezipienten ästhetischer Güter als von vornhinein krisenhaft beschreibt, möchte ich noch folgende Gedanken versuchen.
Die Ausbreitung digitaler Produktions- und Vertriebsmöglichkeiten kultureller Werke in den letzten 50 Jahren hat die Position der Produzenten keineswegs durchgängig verbessert. Zwar besteht rein theoretisch die Möglichkeit ohne weitere Umstände via Internet ein Publikum im globalen Maßstab zu erreichen. Zur gleichen Zeit hat sich die Anzahl der Werke und der Anbieter unter eben diesen Umständen explosionsartig ausgeweitet. (Jede Minute werden 70 Stunden(!) Videomaterial auf Youtube geladen.) Die Chance eines einzelnen Werkes auf Wahrnehmung hat sich damit dramatisch reduziert.
Während Content neuerdings wieder als das Gold des Internets gehandelt wird, haben in diesem Prozess letztlich nur die Aggregatoren von Content (Youtube, Amazon, Apple, Facebook etc.) gewonnen. Sie wurden für Milliarden an die Börse gebracht.
Als Resultat ist eine ungeahnte Spreizung der Aufwerksamkeitswerte entstanden. Die meisten Videos auf Youtube dürften weniger als 500 Clicks erreichen, einige wenige dagegen mehr als 100 Millionen (zb Gangnam Style) [2].
Wenn davon ausgegangen werden kann, daß die Produktionskosten nicht mit den Aufmerksamkeitswerten korrelieren (je teuerer das Video desto mehr Zuschauer?), ist es naheliegend, daß es auf ökonomischer Seite weitaus mehr Verlierer als Gewinner gibt. Und nur, was Zuschauer und Rezipienten in weitestem Sinne findet, lässt sich auch monetarisieren.
Daß staatliche Kulturförderung hier nicht ausgleichend, sondern kontraproduktiv verschärfend wirkt, zeigen nicht nur ein Blick auf den Kulturhaushalt der Stadt Frankfurt, sondern auch die Gedanken des holländischen Ökonoms Hans Abbing [3].
Die eigene (ökonomische) Existenz an die Gratifikation durch ein Publikum zu binden, ist daher mehr als riskant.
Es ist folglich Zeit von der Idee eines Publikums Abschied zu nehmen.
Profane Kreativität (als Ausweg)
Eine Möglichkeit die Rolle des Publikums zu relativieren beschreibt Reckwitz unter dem Begriff der "profanen Kreativität":
Wenn Kreativität bedeutet, dass etwas ästhetisch Neues verfertigt wird, gibt es keinen Grund, sie zwangsläufig an eine Konstellation zu binden, in der ein individueller oder kollektiver Produzent dieses Neue vor einem und für ein Publikum verfertigt, um dessen Aufmerksamkeit und Anerkennung er ringt.
Die Aufmerksamkeit des Publikums zu erringen ist aufwändig, kostspielig, unberechenbar, und somit immer wieder vom Scheitern bedroht.
Als Alternative böte sich folgendes Vorgehen an:
Eine Vorstellung von Kreativität, die sich vom Publikum, vom Vergleich und von der Steigerung emanzipiert, ginge es hingegen um das, was man "profane Kreativität" nennen kann.
Anders als das heroische Modell der Kreativität, das vom Ideal des Künstlers ausgeht, bezeichnet die profane Kreativität ein Phänomen, das sich in den alltäglichen Praktiken und Netzwerken immer schon ergibt und dabei auf kein Publikum angewiesen ist.
Die profane Kreativität findet sich in der Alltäglichkeit individueller, scheinbar banaler Verrichtungen, die ganz ohne Zuschauer auskommen, wie auch in der intersubjektiven Praxis.
So werden zwei Säulen des Kreativitätsdispositivs, die sich bisher in labiler Opposition zueinander befanden, vereint.
Entscheidend für Letztere [Praxis] ist, daß es hier keine Trennung von Produzenten und Publikum gibt, sondern nur Teilnehmer und Mitspieler.
Wenn die Trennung zwischen Produzent und Rezipient aufgehoben ist, macht ihre weiter Fortführung auch keinen Sinn mehr. Reckwitz spricht daher bezüglich der profanen Kreativität von einem "Ereignen" in "der Sequenz der Praxis und der Subjekt-Objekt-Netzwerke". [4]
In der Tat gibt es bereits einige kulturelle Felder und Praktiken, die auf die Existenz eines Publikums verzichten können. Ich möchte aus meinem eigenen Umfeld drei Beispiele vorstellen.
Gartendeck
Urban Gardening, hier am Beispiel des Hamburger Projektes Gartendeck vorgestellt, ist eine kulturelle Herangehensweise, die von ihrer Anlage her keine Zuschauer benötigt. Das Aufziehen von Pflanzen verlangt nach helfenden Händen, die in einer Gemeinschaft einen Garten bestellen. Sofern nicht die Absicht besteht, Gemüse zu verkaufen, sind die Abnehmer der Produkte die Erzeuger selbst. Weitere Öffentlichkeit ist nicht vonnöten.
Konversationskunst
Seit gut 30 Jahren unternehmen Kurd Alsleben und Antje Eske Forschungen zur Praxis einer Konversationskunst. Ausgehend von der Salonkultur des 17. - 19. Jahrhunderts greifen sie Entwicklungen in digitalen Netzen zur Erprobung dialoghafter und konversationeller Situationen auf, die in Wikis, Chats, Videokonferenzen und Gesprächsrunden von Angesicht zu Angesicht münden.
Dabei gehen sie explizit und programmatisch von der Auflösung des Publikums hin zu gleichberechtigten Gesprächsteilnehmern aus.
Wenn wir hier, zusätzlich zur Werke schaffenden Kunst, vom Begehren des Künstlers nach Botschaft, von Kunst als Austausch sprechen - das ist Kunst ohne Publikum und ohne Werkproduktion -, so führen wir mit vorliegenden Berichten ... diese Position aus. [5]
Die von Reckwitz angedachte Aufhebung der Trennung von Produzenten und Rezipienten wird in ihrer Arbeit konsequent verwirklicht.
FritzDeutschland Stadtspaziergänge
In unregelmässigen Abständen lädt die Frankfurter Künstlergruppe FritzDeutschland zu Spaziergängen im Frankfurter Stadtgebiet ein. Ihnen ist eine offene Neigung zueigen, Forschung mit Vergnügen, spielerische Aneignung und sanfte Besetzung mit lockerer Unterhaltung zu verbinden. Erkenntnis und Interesse und ein Glas Apfelwein.
Zu einer solchen Praxis schreibt der Kulturwissenschaftler Sacha Kagan:
Gehen ist somit nicht nur eine alltägliche Praxis, die das Wesen Mensch zutiefst kennzeichnet, sondern auch eine sehr ertragreiche Form von Aktionsforschung. Es gestattet ein beständiges verkörpertes Lernen. Auf dem Gehen basierende Praktiken setzen gelernte Dinge miteinander in Kontext, logisch und ökologisch, indem sie diese in eine reale Landschaft betten und sich nicht nur darauf beschränken, bequeme, aber virtuell bleibende Bezüge herzustellen. Aufgrund des langsameren Rhythmus ihrer Fortbewegung schärft die Gehende beständig ihre Aufmerksamkeit. Durch eine Gegend zu gehen heißt, sich zu verändern, sich auszutauschen, sich mit dem, was man findet, zu vergleichen. [6]
Die Stadtspaziergänge von FritzDeutschland sind allein von ihren Teilnehmern geprägt. Sie bilden in die Öffentlichkeit gehend ihre eigene Öffentlichkeit aus, die vorübergehend von Öffentlichkeit Abstand nimmt.
Theorie einer Kunst ohne Publikum
Ausgehend von den vorherigen Überlegungen und Beispielen lassen sich Charakteristika einer Kunst ohne Publikum wie folgt explizieren:
- ein namenloses und unverbindliches Publikum wird aufgelöst in ein Band von persönlich aufeinander bezogenen Teilnehmern im Hinblick auf einen Austausch von teils spielerischer Ausprägung. Produktion ereignet sich im Rückgriff auf ältere vormoderne Formen der Wohngemeinschaft, Reisegemeinschaft, Erzeugergemeinschaft etc.
- das asymmetrische Verhältnis von Produzenten und Rezipienten mündet in eine symmetrische Beziehung, die dem Geben und Nehmen einen verbindlichen Charakter gibt. Alsleben und Eske sprechen in diesem Zusammenhang daher von "Mutualität" (auf Gegenseitigkeit).
- sofern im Rahmen des Austauschs Gegenstände auftauchen, handelt es sich nicht um finite, abgeschlossene Objekte, die einer distanzierten Betrachtung (Ausstellungssituation) angeboten werden, sondern um vielfältig modifizierbare Produkte, die eher Werkzeug als Werk bedeuten.
Soweit verstanden erklärt eine Kunst ohne Publikum ihre Abkehr von wesentlichen Paradigmen der kulturellen Moderne. Aus der bislang verbindlichen Trias Künstler, Werk und Publikum letzteres heraus zu lösen, verändert ihre Gestalt in einer Weise, die auch Künstler und Werk neu definieren. Der Verlust an Sichtbarkeit kann ihnen neue Freiräume eröffnen.
* * * * * * * * * *
Anmerkungen
* * * * * * * * * *
[1] Andreas Reckwitz, Die Erfindung der Kreativität. Suhrkamp 2012. ISBN 978-3-518-29595-3
[2] Wenn Musil im Mann ohne Eigenschaften einen Möglichkeitssinn prognostizierte, so ist er in ungekannten Ausmassen eingetreten. In der digitalen Ökonomie ist das Mögliche zur dominierenden Kraft geworden, die alle Wirklichkeit hinter sich zurück lässt.
[3] The signaling effect of generally known artists' subsidy programs just adds to the existing misinformation and in doing so, make the arts seem even more attractive. Subsidies for artists lead to more artists, lower incomes, and more poverty. (Thesis 46)
Hans Abbing, Why are artists poor?, S. 139
[4] Alle Zitate Reckwitz Seite 358 u. 359.
[5] Alsleben/Eske 2006, siebenundzwanzig bremer Netzkunstaffairen, ISBN 978-3-8370-6155-0
[6] Sacha Kagan, Auf dem Weg zu einem globalen (Umwelt-) Bewusstseinswandel - Über transformative Kunst und eine geistige Kultur der Nachhaltigkeit. Heinrich-Böll-Stiftung 2012
- Schreib einen Kommentar
- 50 Herzen
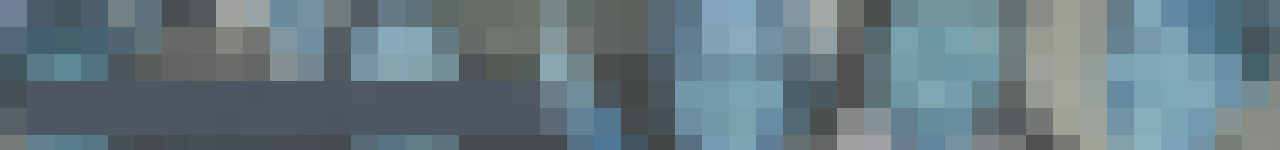
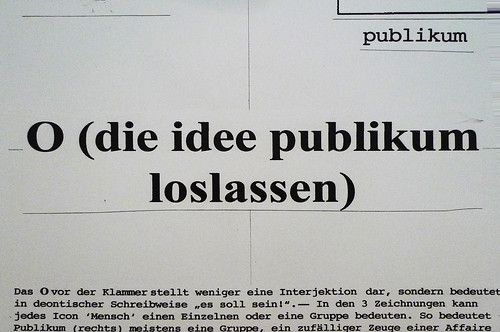



Modell der Versorgung
Hallo Stefan,
"Thing Frankfurt schläft noch"? Das habe ich zum ersten Mal gesehen !
Dann muss meine Nachfrage hier hin: Du sprachst im Zusammenhang mit "materiellem Erfolg" vom "Lackmustest", weil Du "irgendwann von Deinen Sachen leben" können möchtest. Kannst Du mir ein Modell versuchen zu erklären, das die Versorgung aller derart kreativ Tätigen sichern könnte, abseits der Idee des Grundeinkommens, die ich befürworte?
25.7. 2013 - 9:47
Re: Modell der Versorgung
Hallo Sabine,
Thing Frankfurt ist manchmal etwas schläfrig. Das muss an der Hitze liegen :)
Nein, ich kann Dir auch kein Modell erklären, das die Versorgung aller kreativ Tätigen sicher stellen würde.
Aber ich denke, es gibt im Groben vielleicht zwei oder drei Stossrichtungen:
a) Ausweitung der Mittel, die für Kulturschaffende zur Verfügung stehen. Bzw. Umverteilung weg von Institutionen hin zu einzelnen Künstlern. Dann würde auch schon das bestehende Geld ausreichen.
b) Verknappung. Also Begrenzung des Personenkreises, der Leistungen in Anspruch nehmen kann oder ausführen darf. Sichert ja bei vielen anderen Berufsgruppen mittels Zugangsbeschränkungen das Einkommen.
c) Mehr als Seitwärtsbewegung, ein anderer Kulturbegriff, wie ihn Reckwitz andeutet. Dann würden Kulturschaffende Leistungen anbieten, die anderswo von der Gesellschaft ordentlich bezahlt werden. Momentan scheint sich da ein gewisser Trend bei Immobilien anzubahnen. Das Künstlerhotel in Hamburg wäre so ein Beispiel. Oder Beratungsleistungen bei der kulturellen Einbettung größerer Bauprojekte. Müsste allerdings noch genauer untersucht werden.
Grüße
Stefan
25.7. 2013 - 17:43
Re: Modell der Versorgung
Hallo Stefan,
mir fällt es sehr schwer, Kunst immer nur oder vorwiegend unter dem Versorgtseinsanspruch zu betrachten; dass das wichtiger sei als der Aspekt, dass möglichst Viele sich egal wie damit beschäftigen. Dass das wichtiger sei als der Aspekt, sich grundsätzlich kreativ zu entwickeln und auszudrücken.
Mir wäre es lieber, jeden Menschen so anzuleiten, dass eine kreative, eine künstlerische Herangehensweise als eine vollkommen normale zusätzliche "Sprache" empfunden wird, etwas, dessen Bezahlung als völlig unpassend angesehen wird, ähnlich der Idee, Wasser an der Börse zu handeln. Kunst gehört allen Menschen.
Sie machte für mich keinen Sinn, wenn sie nur für eine Elite wäre, die umeinander kreist und sich nur untereinander verstünde. Da das immer noch mehr so verstanden wird, da eine andere, einladendere Herangehensweise von Kindesbeinen an fehlt, kann man solche Argumente, wie Du sie vertrittst, vertreten und Kunst als einen Beruf ansehen, den einige ausüben und viele eben nicht. Ich kann das nicht sehen. Berufen ist zu eigen, dass in vergleichbaren Sparten Wettbewerb stattfindet; Menschen kaufen etwas, das für sie einen direkten Nutzwert hat.
Kunst ist bereichernder Austausch ohne direkten Nutzwert, und AUSTAUSCH muss man nicht VERKNAPPEN, sondern fördern. Dazu einladen, statt auszugrenzen.
29.7. 2013 - 11:40
Re: Modell der Versorgung
Liebe Sabine,
ich glaube, wir gehen wieder einmal von zwei verschiedenen Kunst-Begriffen aus.
Wenn Du Kunst als eine allgemein menschliche Fähigkeit oder Sensibilität verstehst, etwas, das auch in der Richtung von Reckwitz "profaner Kreativität" liegt, dann ist die Frage nach der Bezahlung derer, die sie ausüben eher zweitrangig. Dann bliebe noch die Frage, welche gesellschaftlichen Resourcen bereit zu stellen wären, um sie zu fördern und auszuprägen, und ob es dazu speziell befähigter Personen (Kunst-Pädagogen) bedürfte.
Meine Überlegungen gingen aber von der Existenz eines funktionell ausdifferenzierten Feldes aus, das nach Autonomie strebt, und in dem Personen tätig sind, die nichts anderes als Kunst machen, und dafür nach Anerkennung durch ein sensibilisiertes Publikum sowie durch taxierende Institutionen streben. Hier ist die Frage nach der Bezahlung der Produzenten dringend und notwendig, denn sie berührt ja direkt die von dem Feld angestrebte Autonomie.
Um an die weiter oben getätigten Erörterungen anzuschliessen, - ein solches Feld erzeugt unter den gegenwärtigen Bedingungen extreme Einkommensunterschiede und ist daher als fraglich anzusehen.
Grüße
Stefan
Re: Abschied vom Publikum
Kommentar zu Stefan Beck: Abschied vom Publikum
auf www.thing-frankfurt.de/content/2013/abschied-vom-publikum
Hallo Stefan,
gerade habe ich meinen alten Kommentar zu „Re: Anmerkungen zum Ende der Ausstellungskunst“ vom 5.7.2008 gefunden, den ich aus aktuellem Anlass noch einmal genau so posten konnte, wie er damals geschrieben wurde. Und ich will sagen: er passte auch als Antwort hier hin.
Trotzdem versuche ich natürlich wieder neue Worte und habe auch wie üblich wieder Fragen dazu.
Ich hatte ja schon das seminar gehört und wir haben uns bereits schriftlich darüber unterhalten; die Reckwitz’sche Theorie noch einmal nachzulesen, hat, glaube ich, Einiges zur Erklärung beigetragen, aber auch wieder Fragen neu aufgeworfen bzw. den Bezug zu meinem oben genannten damaligen Kommentar hergestellt.
*
Einsteigen möchte ich an Deinem Absatz
„Problematisierung des Publikums
Zusätzlich zu den Ausführungen von Reckwitz, der die Beziehung zwischen Produzenten und Rezipienten ästhetischer Güter als von vornhinein krisenhaft beschreibt, möchte ich noch folgende Gedanken versuchen.“
Da habe ich mich spontan gefragt: warum denn „krisenhaft“? Dieser Ausdruck kann doch nur aus enttäuschter Erwartung entstehen. Was war diese Erwartung? Dass alle Künstler 1. wahrgenommen werden können und 2. durch ihr Schaffen materiell versorgt sein können.
Das wird aber vereitelt durch die Vielzahl; Du schreibst:
„Die Chance eines einzelnen Werkes auf Wahrnehmung hat sich damit dramatisch reduziert.“
Der Umkehrschluss bei Vielen ist daher: die Vielzahl ist das Übel. Wenn man wie ich diese aber als Bereicherung empfindet und nicht mehr auf mannigfaltigen, nicht diskriminierten kreativen Ausdruck verzichten mag – also ja völlig gegensätzlich an die „Problemstellung“ herangeht – muss etwas anderes das Übel sein.
Dann sind wir spätestens jetzt bei Definitionen.
Du schreibst weiter:
„Wenn davon ausgegangen werden kann, daß die Produktionskosten nicht mit den Aufmerksamkeitswerten korrelieren (je teuerer das Video desto mehr Zuschauer?), ist es naheliegend, daß es auf ökonomischer Seite weitaus mehr Verlierer als Gewinner gibt. Und nur, was Zuschauer und Rezipienten in weitestem Sinne findet, lässt sich auch monetarisieren.“
und weiter:
„Die eigene (ökonomische) Existenz an die Gratifikation durch ein Publikum zu binden, ist daher mehr als riskant.
Es ist folglich Zeit von der Idee eines Publikums Abschied zu nehmen.“
An dieser Stelle fühlte ich mich zu schnell durch die Gedankenwelle gezogen. Du bindest das Publikum fest an den materiellen Erfolg des Künstlers, wenn ich Dich richtig verstehe. Das schränkt seine Rolle ja schon einmal dramatisch ein. Das meinte ich in meinem ersten Kommentar ‚Unter Umständen fühlte sich der eine oder andere als Rezipient nur noch geschätzt, wenn er zudem die theoretische Möglichkeit der Kaufkraft mitbringt… das zerstörte den freien Blick auf die Sache.’ zu Deiner seminar-Sendung. Daher sollte man selbstverständlich die eigene ökonomische Existenz nicht an die monetäre(!) Gratifikation durch ein Publikum hängen.
Aber meine Definition lässt Dein „folglich“ nicht zu; es ist „folglich Zeit, von der Idee eines Publikums Abschied zu nehmen“. Das eine hat mit dem anderen erst einmal nichts zu tun, will man die Rolle des Publikums nicht auf die des „Geldgebers“ beschränken.
*
Das „Gartendeck“ scheint für mich – obschon natürlich kulturell wertvoll – ein Projekt ohne explizit künstlerischen Anspruch zu sein, ähnlich unserem Margarethengarten in Mönchengladbach-Eicken [http://www.youtube.com/watch?v=5_evHAAy3Zo]. Aber dadurch taugt es für mich nicht als Beispiel dafür, dass Kunst kein Publikum (mehr) bräuchte.
*
Im Abschnitt
Konversationskunst
zitierst Du dann Kurd Alsleben und Antje Eske, dass diese
„explizit und programmatisch von der Auflösung des Publikums hin zu gleichberechtigten Gesprächsteilnehmern aus“gehen
‚Wenn wir hier, zusätzlich zur Werke schaffenden Kunst, vom Begehren des Künstlers nach Botschaft, von Kunst als Austausch sprechen - das ist Kunst ohne Publikum und ohne Werkproduktion -, so führen wir mit vorliegenden Berichten ... diese Position aus. [5]’
Ohne es „Auflösung des Publikums“ zu nennen hat das immer schon meine Kunstauffassung geprägt. Für mich gab und gibt es keine Trennung zwischen „Werke schaffender Kunst“ und „Kunst als Austausch“ – Kunst ist Austausch, immer. Wollten frühere Künstler den nicht? Die Meisten wollten und wollen doch sicher Austausch durch ihre Arbeiten! Dabei verstehe ich das „Werk“, die Arbeit sozusagen als „Gesprächseinstieg“.
Ich kann daher aus dieser Argumentation heraus noch nicht an eine „Auflösung“ des Publikums glauben.
Im Abschnitt
Theorie einer Kunst ohne Publikum
rekapitulierst Du dann
„- ein namenloses und unverbindliches Publikum wird aufgelöst in ein Band von persönlich aufeinander bezogenen Teilnehmern im Hinblick auf einen Austausch von teils spielerischer Ausprägung.“
Bedeutet das im Umkehrschluss, dass ein damaliges, ein früheres Publikum durch eine andere Art der Rezeption durch die Bank qualitativ „schlechter wahrgenommen“ hätte? Dann könnte ich die Aussage nämlich keinesfalls teilen, da früher wie heute so etwas wohl ziemlich individuell zu bewerten wäre, wollte man das denn tun.
„- das asymmetrische Verhältnis von Produzenten und Rezipienten mündet in eine symmetrische Beziehung, die dem Geben und Nehmen einen verbindlichen Charakter gibt. Alsleben und Eske sprechen in diesem Zusammenhang daher von "Mutualität" (auf Gegenseitigkeit).
Auch hier: Für mich beruht es schon immer „auf Gegenseitigkeit“, sonst findet keine „Kunst“ statt, sondern jemand „guckt sich nur an“, was ein anderer erschaffen hat. „Kunst“ = Austausch ist immer gegenseitig.
Auf mich wirkt es, als strebten sie an, eine Reaktion des Publikums (ich bleibe vorläufig mal bei der Bezeichnung) beinahe zu erzwingen, zumindest aber unmittelbar sichtbarer zu machen. Das war ja auch schon die Idee von Fluxus Jahrzehnte zuvor.
„- sofern im Rahmen des Austauschs Gegenstände auftauchen, handelt es sich nicht um finite, abgeschlossene Objekte, die einer distanzierten Betrachtung (Ausstellungssituation) angeboten werden, sondern um vielfältig modifizierbare Produkte, die eher Werkzeug als Werk bedeuten.“
Das „Werk“ war doch immer schon „nur“ der Ausgangspunkt, der Beginn des Austauschs. Sicher findet der im Museum oft nicht „sichtbar lebendig“ statt, aber ein Gegenbeispiel ist aktuell doch z. B. Tomás Saraceno mit seiner Arbeit „in orbit“, derzeit zu sehen im Düsseldorfer Ständehaus K 21 [http://www.youtube.com/watch?v=ROqL-8h_7DM].
*
Aus allem ergibt sich eine Fazit-Frage und ein Fazit; zuerst die Frage: ist es wirklich eine „Alternative“, wie Du im Untertitel zu Deinem Artikel schreibst, die den Namen verdient? Oder ist die Kunst nicht wieder nur um mindestens eine Form reicher geworden durch die mögliche unmittelbare Beteiligung des Publikums (die es als Idee ja schon länger gibt)?
Als mein Fazit möchte ich aus einem meiner älteren Texte zitieren; dort ging es im Grunde um die unabdingbare Toleranz zwischen Kreativschaffenden, aber hier möchte ich es allgemeiner verstanden wissen:
Toleranz ist daher für mich auch hier die logische Schlussfolgerung und der einzig gangbare Weg, diesen wunderbaren Begriff und das, was er für jeden von uns individuell heißt, zu leben.
In meinem eingangs angesprochenen Kommentar schrieb ich – und ich unterschreibe es immer noch – : Ich unterstütze den Dialoggedanken in der Kunst leidenschaftlich! Nach allen möglichen Thesen kann dann auch eine Arbeit, ein "Werk" abgeschlossen sein - die mögliche Kunstempfindung wird es nie sein.
Viele Grüße, Sabine
P.S.: In meinem Word-Dokument ist es besser zu lesen durch unterschiedliche Schriften und andersfarbige Absätze...
Beziehung zum Publikum
Liebe Sabine,
vielen Dank für Deinen so ausführlichen Kommentar. Allerdings hat mir seine Länge und die Vielzahl der angesprochenen Punkte doch einige Schwierigkeiten bereitet.
Ich habe versucht hier in einzelnen Kommentaren diese Punkte anzusprechen.
Ich möchte Dich bitten, zu versuchen in möglichen Antworten jeweils nur ein Stichwort anzusprechen. Sonst wirds komplett unübersichtlich.
Stefan
Da habe ich mich spontan gefragt: warum denn „krisenhaft“? Dieser Ausdruck kann doch nur aus enttäuschter Erwartung entstehen. Was war diese Erwartung? Dass alle Künstler 1. wahrgenommen werden können und 2. durch ihr Schaffen materiell versorgt sein können.
Die Beziehung Künstler und Publikum ist ein so großer Bereich, daß auch Reckwitz ihn nur ein wenig streifen kann, und ich ihn dann noch kürzer als "krisenhaft" charakterisiere.
Wirklich nur ganz kurz: Die Künste sind wahrscheinlich der einzige Bereich in der Beziehung von Produzenten und Konsumenten, wo es mit voller Berechtigung möglich ist, davon zu sprechen, daß die Konsumenten am Produkt und Produzent scheitern können.
Also, wenn man sagt, das Publikum sei am Werk oder Künstler XY "gescheitert". (19 Jhd. --> "verkanntes Genie").
Gleichzeitig ist es nicht grundsätzlich der Fall. Nicht immer bedeutet Mißerfolg beim Publikum, daß der Künstler Recht behält. Wie umgekehrt auch Erfolg beim Publikum in Frage gestellt werden kann. "Kitsch", "Massengeschmack".
Mit "krisenhaft" wollte ich diese Dialektik verstanden wissen.
Vielzahl ist das Übel
Der Umkehrschluss bei Vielen ist daher: die Vielzahl ist das Übel. Wenn man wie ich diese aber als Bereicherung empfindet und nicht mehr auf mannigfaltigen, nicht diskriminierten kreativen Ausdruck verzichten mag – also ja völlig gegensätzlich an die „Problemstellung“ herangeht – muss etwas anderes das Übel sein.
Nun ja, für den Benutzer von Youtube ist das natürlich eine Bereicherung. Für den Produzenten nicht. Das sind zwei Seiten der Medaille.
Materieller Erfolg
Du bindest das Publikum fest an den materiellen Erfolg des Künstlers, wenn ich Dich richtig verstehe....
Das eine hat mit dem anderen erst einmal nichts zu tun, will man die Rolle des Publikums nicht auf die des „Geldgebers“ beschränken.
Ich bin nicht sicher, ob ich Dein Argument im folgenden Absatz verstehe.
Du willst sagen, daß das Publikum ja auch Beifall spenden, oder sonst Interesse zeigen kann? Sicherlich. Aber ich habe hier mit Absicht von "materiellem Erfolg" gesprochen. Denn das ist der Lackmustest. Irgendwann will man doch auch von seinen Sachen leben. Ich jedenfalls.
Gartendeck
Das „Gartendeck“ scheint für mich – obschon natürlich kulturell wertvoll – ein Projekt ohne explizit künstlerischen Anspruch zu sein...
Das mag sein. Aber ich hab es hier aufgenommen, weil ich die Verfahrensweise interessant finde.
Kunst als Austausch
Für mich gab und gibt es keine Trennung zwischen „Werke schaffender Kunst“ und „Kunst als Austausch“
Versteh ich nicht. Ein Gemälde ist ein Werk. Physisch und abgeschlossen.
Eine Konversationsrunde ist kein (physisches) Werk. Sie existiert nur für den Moment. Wenn sie zu Ende geht bleibt sie evtl. nur im Gedächtnis der Teilnehmer
Früheres Publikum
Bedeutet das im Umkehrschluss, dass ein damaliges, ein früheres Publikum durch eine andere Art der Rezeption durch die Bank qualitativ „schlechter wahrgenommen“ hätte?
Nein, keineswegs schlechter. Hier geht es um den Unterschied von "wahrnehmen" (als rein passiver Akt) und "partizipieren" im Sinne von sich einbringen, Veränderungen vornehmen.
Und um die Auflösung der Relation von Produzent und Rezipient als einem Verhältnis (oftmals) von "one to many" zu "one to one". (Weiss nicht wie man das besser in Deutsch sagt?)
Auf Gegenseitigkeit
„Kunst“ = Austausch ist immer gegenseitig.
Das kommt drauf an, wie man Austausch versteht. Ein Bild in einer Galerie ermöglicht normalerweise keinen Austausch. Siehe unten.
Ja, Alsleben und Eske, und ich auch, verstehen unter "Mutualität" eine gewisse Verpflichtung: Ich gebe Dir, und Du gibts mir. Da es sich um eine konversationelle Übung handelt, wird das Geben-Nehmen auch entsprechend quittiert.
Werk als Austausch
Das „Werk“ war doch immer schon „nur“ der Ausgangspunkt, der Beginn des Austauschs.
Ich meine hier "Austausch" sehr physisch und konkret. Gegenüber einem Bild in einer Galerie kann Austausch nur metaphorisch stattfinden. Es sei denn, der Künstler würde zB erlauben durch beigestellte Farbe es zu verändern.
Alternative
Aus allem ergibt sich eine Fazit-Frage und ein Fazit; zuerst die Frage: ist es wirklich eine „Alternative“, wie Du im Untertitel zu Deinem Artikel schreibst, die den Namen verdient? Oder ist die Kunst nicht wieder nur um mindestens eine Form reicher geworden durch die mögliche unmittelbare Beteiligung des Publikums (die es als Idee ja schon länger gibt)?
Ich will nicht sagen, daß es von nun an nur noch Kunst ohne Publikum geben sollte.
Ich wollte die Relevanz des Publikums antesten und anhand von Beipielen, überlegen, welche Alternativen möglich wären.